
Der Zorn des (Un-)Gerechten
Es braucht eigentlich keine Beweise mehr dafür, dass auf deutschen Straßen dicke Luft ist. Autofahrende schimpfen über Radfahrende, Radfahrende über Autofahrende, Fußgänger über beide und vice versa. Es geht um die Verteilung einer knappen Ressource: Verkehrsraum.
Dieser Kampf ist härter geworden. Behörden verzeichnen eine stark steigende Zahl von Fremdanzeigen wegen Verkehrsverstößen. In Berlin etwa waren es 2020 rund 45.000, in Köln mehr als 42.000 und 19 Prozent mehr als im Jahr davor. Radfahrende organisieren sich zunehmend, es gibt Apps, die solche Anzeigen erleichtern und in Teilen automatisieren. Das Smartphone ist als Dokumentationswerkzeug immer dabei. Bei diesem Kampf geht es um ein Gefühl von Gerechtigkeit. Was ja oftmals gleichzusetzen ist mit dem Bedürfnis, Recht zu haben.
Doch das mit dem Recht ist so eine Sache, wie ein Münchner kürzlich feststellen musste. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, auf seinem Arbeitsweg radelnd, falsch parkende Autos zu fotografieren. Die Fotos schickte er an die Polizei und forderte sie auf, gegen das Falschparken vorzugehen. Die Folge: Eine mit 100 Euro Gebühr bewehrte Verwarnung – für den Fotografen, nicht für die Falschparker (soweit das dokumentiert ist).
Das Kuriose ist ja, dass man gleichzeitig im Recht sein und unrechtmäßig handeln kann. Nach Auffassung des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht (LDA), das die Verwarnung aussprach und die Gebühr verhängte, war der Fotograf im Unrecht: Indem er die Kfz-Kennzeichen fotografierte und an die Polizei weiterleitete, habe er personenbezogene Daten rechtswidrig verarbeitet. Damit verstoße er gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der Mann klagt vor dem Verwaltungsgericht Ansbach gegen die Entscheidung und bekommt dabei namhafte Unterstützung. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) finanziert die Klage und hilft anwaltlich.
Die DUH ist sowas wie das Boulevardblatt unter den Umweltverbänden. Sie hat ein unverkrampftes Verhältnis zum Populismus. In ihrer Pressemitteilung zum Fall schreibt sie unter anderem: „Dass der Freistaat Bayern die Datenschutz-Grundverordnung missbraucht, um zivilgesellschaftliches Engagement zu verhindern, ist ein Skandal.“
Man kann das so sehen, kann den Furor aber auch übertrieben finden. Der Freistaat Bayern ist nicht allein in dieser Beurteilung derartiger Fälle. Die „systematische Verkehrsüberwachung“ durch Privatleute sehen viele Behörden problematisch, es handelt sich schließlich um eine hoheitliche Aufgabe. Und für die Verarbeitung personenbezogener Daten braucht es nun mal einen guten Grund. Das könnte zum Beispiel persönliche Betroffenheit sein. Wer sich hingegen als Hilfssheriff betätigt und einfach Falschparker fotografiert und anzeigt, der hat dazu eben keinen guten Grund.

Seit mehr als 10 Jahren setzt die österreichische Post Elektrofahrzeuge ein. Im Stop-&-Go-Praxiseinsatz haben die Fahrzeuge das Logistik-Unternehmen überzeugt. Nun soll Österreichs – schon jetzt – größte Elektroflotte weiter wachsen. Insgesamt besteht die E-Flotte aus rund 2.500 Fahrzeugen. Diese teilen sich auf in 1.400 elektrisch angetriebene Zustellfahrzeuge und 1.100 E-Bikes, Lasten- und Dreiräder mit E-Antrieb für den Lieferbetrieb auf der letztem Meile. In diesem Jahr sollen 800 neue E-Transporter hinzukommen, und für 2023 plant die Post mit nochmals 1.300 zusätzlichen elektrischen Zustellfahrzeugen.
Den Weg zur Flotten-Elektrifizierung fasst Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG zusammen: „Ab sofort schaffen wir keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren für die Zustellung an, stattdessen investieren wir 2022 und 2023 über 80 Millionen Euro in E-Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur.“
Bei Klein-Transportern mit einem Ladevolumen von etwa 4 m³ setzt die Post auf Modelle von Citroën, Opel, Nissan und Renault. Eine Stufe darüber, bei den Fahrzeugen mit einem Ladevolumen von etwa 6 m³, kommen Elektromodelle von Peugeot zum Einsatz. Noch größere Transporter, ab 11 m³ Ladevolumen, stammen von Mercedes und MAN. Laut der Post reichen die elektrischen Reichweiten der heute verfügbaren Fahrzeugmodelle bereits aus, um mehr als 90 Prozent aller Zustellbezirke in Österreich rein elektrisch anzufahren.
Viele neue E-Autos brauchen auch viele neue Ladestationen. Laut der Österreichischen Post 6.000 an der Zahl. Dazu baut das Unternehmen seine Postbasen unter anderem mit Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung aus. Zukaufen will das Unternehmen ausschließlich grünen Strom aus Österreich.

Denn früher war alles ... anders.
Retro-Feeling fürs Elektroauto? Ein E-Auto kommt im Normalfall mit einer Übersetzung aus. Deshalb benötigen die meisten Stromer kein klassisches Getriebe mit Kupplungspedal und Schaltknauf. Aber weil früher bekanntlich alles besser war, beschert Toyota seinen Kund*innen bald ein ganz besonderes Erlebnis. Die Japaner haben eine virtuelle Schaltung für E-Autos entwickelt, vermutlich gegen den erbitterten Widerstand seiner besten Ingenieur*innen. Denn eine Schaltung braucht ein E-Auto zwar nicht. Geht es nach Toyota, einige Nostalgiker*innen aber vielleicht doch.
Zu der Patentanmeldung von Toyota zählen ein simuliertes Kupplungspedal, eine simulierte Gangschaltung und eine Funktion zur Unterbrechung des Drehmoments. Letztere soll den Vortrieb unterbrechen, um so das Fahrgefühl eines klassischen Getriebes zu simulieren. Doch dabei bleibt es nicht: Ein Steuergerät berechnet die virtuelle Drehzahl des ebenfalls virtuellen Motors und zeigt die virtuelle Motordrehzahl auf dem ganz wahrhaftigen und nicht virtuellen Display hinter dem Lenkrad an.
Doch es geht noch weiter: Kupplung und Schalthebel vibrieren und leisten leichten Widerstand, um eine Gang-Mechanik vorzutäuschen. Auf einen hakelnden dritten Gang muss also auch beim E-Auto künftig niemand mehr verzichten. Ergibt es Sinn, neue Technologie zu nutzen, um alte zu simulieren? Vermutlich dann, wenn man glaubt, auf diese Weise dem Autofahrenden den Umstieg vom Geliebten auf das Unbekannte zu erleichtern.
Betreibt Toyota Historienpflege?
Mercedes verbannt langsam aber sicher die Handschaltung aus seinen Modellen. Kostenreduktion und Produktions-Rationalisierung nennen die Stuttgarter als Gründe. Im Grunde betreibt Toyota mit seiner Handschalter-Imitation so etwas wie Historienpflege. Denn mit der Handschaltung verhält es sich ein wenig wie mit dem Anruf-Annehmen-Symbol vom Handy, das einen klassischen Telefonhörer zeigt. Es dauert nicht mehr lange bis junge Menschen nachfragen, was dieses Symbol bedeuten soll, weil die Abbildung eben so ganz und gar nicht wie ein (heutiges) Telefon aussieht. Und genau so, wie niemand weiß wozu das dritte Pedal am Klavier da ist, werden sich Jüngere dies mit Blick auf das Kupplungspedal fragen. Und der Stab in der Mittelkonsole ist zum Festhalten bei schnellen Kurven, oder? Die alte Technik geht uns nicht verloren, weil Toyota sie konserviert.
Und trotzdem bleibt der Beigeschmack, bei jedem Treten der Kupplung und bei jeder Bewegung des Schaltknaufs einer schnöden Beschäftigungstherapie zugeführt zu werden. Kann man sich dem Wissen über die absolute Zwecklosigkeit seines Handelns überhaupt dauerhaft entziehen? Kommt man sich nicht irgendwann veräppelt vor?
Zu Hause höre ich gerne Schallplatten. Nach 15 bis 20 Minuten muss die Platte gedreht, nach 40 Minuten gewechselt werden. Ganz schön viel Aufwand, schließlich passen auf meine 1 Terrabyte Festplatte rund 200.000 Musiktitel und die muss ich nicht nach der Hälfte umdrehen. Trotzdem vermittelt mir der Kontakt zur Schallplatte ein ganz besonders Gefühl. Es vermittelt eine Wertschätzung dem Material und der Kunst gegenüber, die auf ihr verewigt ist.
Wenn die Nostalgiker dasselbe Gefühl beim Griff zum Schalthebel empfinden, sollen sie doch bitte ganz ohne Häme sich an jedem hakeligen Gang, an jeder Drehmoments-Unterbrechung und an jeder Bewegung der virtuellen Nadel des virtuellen Drehzahlmesser ihres virtuellen Motors erfreuen. Toyota, go for it!

Endlich funktioniert er wieder. Südafrikas – einziger – Führerscheindrucker ist nach seiner Reparatur in Deutschland zurück in Südafrika und wieder im Betrieb. Im November gab die 30 Jahre alte Maschine aus Deutschland den Geist auf. Hunderttausende Südafrikaner*innen fahren seitdem mit abgelaufener Fahrlizenz. Im Kap-Staat müssen die Autofahrer*innen ihre Fahrerlaubnis alle fünf Jahre erneuern.
Zur Reparatur wurde die große Anlage extra nach Deutschland verschickt. Nun ist sie zurück und druckt wieder anstandslos Führerscheine: „Wir sind wieder in Betrieb, wir arbeiten sehr hart – Halleluja“, freute sich der zuständige Verkehrsminister Fikile Mbalula. Zugleich bedeutete der Ausfall für ihn einen Weckruf. Die Maschine aus Deutschland sei sehr alt, aber es „wird eine neue Maschine geben, die der entwickelten Welt ebenbürtig sein wird“, kündigte Mbalula an. Diese müsse bei einem Defekt dann auch nicht erst nach Deutschland verbracht werden – halleluja! Nun arbeiten die Mitarbeitenden den Rückstau der vergangenen Wochen ab. Medienberichten zufolge handle es sich dabei um mehr als 400.000 Anträge.

In der einzigen vollelektrischen Weltmeisterschaft im Motorsport – der Formel E – gibt es einen Wechsel. Der Mini Electric Pacesetter verabschiedet sich als Safety Car und macht Platz für den Porsche Taycan Turbo S. Den ersten Einsatz hat die elektrische Sportlimousine aus Zuffenhausen am 28. und 29. Januar im saudi-arabischen Diriyah.
Zwei Elektromotoren, jeweils an Hinter- und Vorderachse leisten zusammen 761 PS. Den knapp 2,4 Tonnen schweren Taycan beschleunigen sie in 2,8 Sekunden auf 100 km/h. Damit könnte der Taycan sogar mit den Formel-E-Gen2-Rennfahrzeugen konkurrieren. Die kommen bei der Beschleunigung nämlich auf denselben Wert. Maximal fährt der Taycan 260 Kilometer pro Stunde schnell.
Für die Aufgaben als Safety Car waren allerdings einige Modifikationen am Fahrzeug notwendig. So verfügt Der Taycan Turbo S natürlich über einen Überrollbügel und Rennschalensitze mit Sechs-Punkt-Gurten. Zudem montierten die Ingenieure die Safety-Car-Beleuchtung auf dem Dach und Blitzlichter in die Stoßstangen. Fahren wird das Safety Car der ehemalige Rennfahrer Bruno Correia. Mit den Aufgaben eines Safety-Car-Fahrenden kennt sich der 45-jährige Portugiese aus. Er ist nicht nur zuvor den Mini Electric Pacesetter gefahren. Correia steuerte außerdem bei den Tourenwagen-Weltmeisterschaft und beim European Touring Car Cup das Safety Car.

Jeder, der schon mal vom Ruhrgebiet Richtung Frankfurt gefahren ist, kennt sie: Die Rahmedetalbrücke ist eine der markantesten Stellen der A45. Kurz vor Weihnachten wurden Risse und Beulen in Quer- und Längsträgern des gewaltigen Bauwerks gefunden. Seitdem ist die Sauerlandlinie zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Folge: Vom Dauerstau frustrierte Pendler*innen und Anwohner*innen, die selbst für kürzeste Stadtfahrten plötzlich mehrere Stunden einplanen müssen. Die 80.000-Einwohner-Stadt Lüdenscheid wird regelrecht überrollt von der Verkehrslawine.
„Das ist eine Katastrophe, weil wir hier einer enormen Verkehrslast ausgesetzt sind“, kommentierte Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (SPD) die Abschlussuntersuchung einer Expertenrunde, die den sofortigen Abriss der Brücke empfiehlt: „Die Anwohner an den Umleitungsstrecken müssen damit rechnen, auf Jahre hinaus mit Stau, Abgasen und Lärm zu leben.“
Bis zuletzt hatten die Lüdenscheider*innen darauf gehofft, dass die Autobahnpassage wenigstens für Autos oder mit strengen Tempobegrenzungen wieder freigegeben werden könnte. Doch die Schäden an den Trägern sind zu massiv. Eine Sprengung der Brücke wäre nun der schnellste Weg, um mit einem Neubau beginnen zu können. Da unter der Brücke jedoch Wohnhäuser und Fabriken stehen, gilt diese Maßnahme als unwahrscheinlich. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die A45 frühestens in fünf Jahren wieder voll befahren werden könne. Bis dahin heißt es für alle Pendler*innen wie für viele Lüdenscheider*innen: Stau, Stau, Stau.

Viele Fahrer*innen haben eine innige Beziehung zu ihrem Auto. Urlaube, Abenteuer und manchmal erhebliche Teile der Familiengründung erleben wir zwischen A- und C-Säule. Abenteuer wollte auch Toumas Katainen erleben und kaufte sich ein gebrauchtes Elektroauto – ein Tesla Model S aus dem Jahr 2013. Doch allzu viele Abenteuer waren dem Finnen mit seiner neuen Errungenschaft nicht beschieden, denn nach nur 1.500 Kilometern blieb das Auto stehen. Die Anzeigen, übersät von Fehlermeldungen, zwangen Fahrer und Fahrzeug zum Stillstand. Nichts ging mehr. Ein Abschleppunternehmen musste das Model S in die Werkstatt bringen. Dort stand es nun Tag ein Tag aus, einen ganzen Monat lang.
Den Anruf heiß ersehnt, meldete sich eines Tages die Werkstatt. Gute Nachrichten hatte sie jedoch nicht zu vermelden. Das Auto sei nahezu irreparabel, die Garantie längst erloschen. Die gesamte Batterieeinheit müsse erneuert werden. Für 20.000 Euro könne man dem Model S jedoch neues Leben einhauchen. Doch Toumas hatte andere Pläne: „also habe ich ihnen gesagt, dass ich komme, um mein Auto abzuholen, und es in die Luft zu jagen“.
Gesagt, getan. Toumas holte sein Model S ab und kontaktierte die Betreiber des Youtube-Kanals „Pommijätkät“. Die kennen sich mit allem aus, was „BUMM“ macht. Kurze Zeit später steht das weiße Tesla Model S in der Nähe des Dorfs Jaala in der südfinnischen Region Kymenlaakso, drapiert mit 30 Kilogramm Sprengstoff. Den Auslöser durfte Toumas selbst betätigen. Auf Knopfdruck ging der Luxuswagen in einem großen Feuerball auf. Die 30 Kilogramm „Dynamiittia“ ließen von dem Wagen kaum etwas übrig. Sein Werkstatt-Debakel sieht Toumas gelassen: „Ab und zu gehen Dinge einfach schief. Dann ist es an der Zeit, dass die finnische Unnachgiebigkeit die Führung übernimmt“.
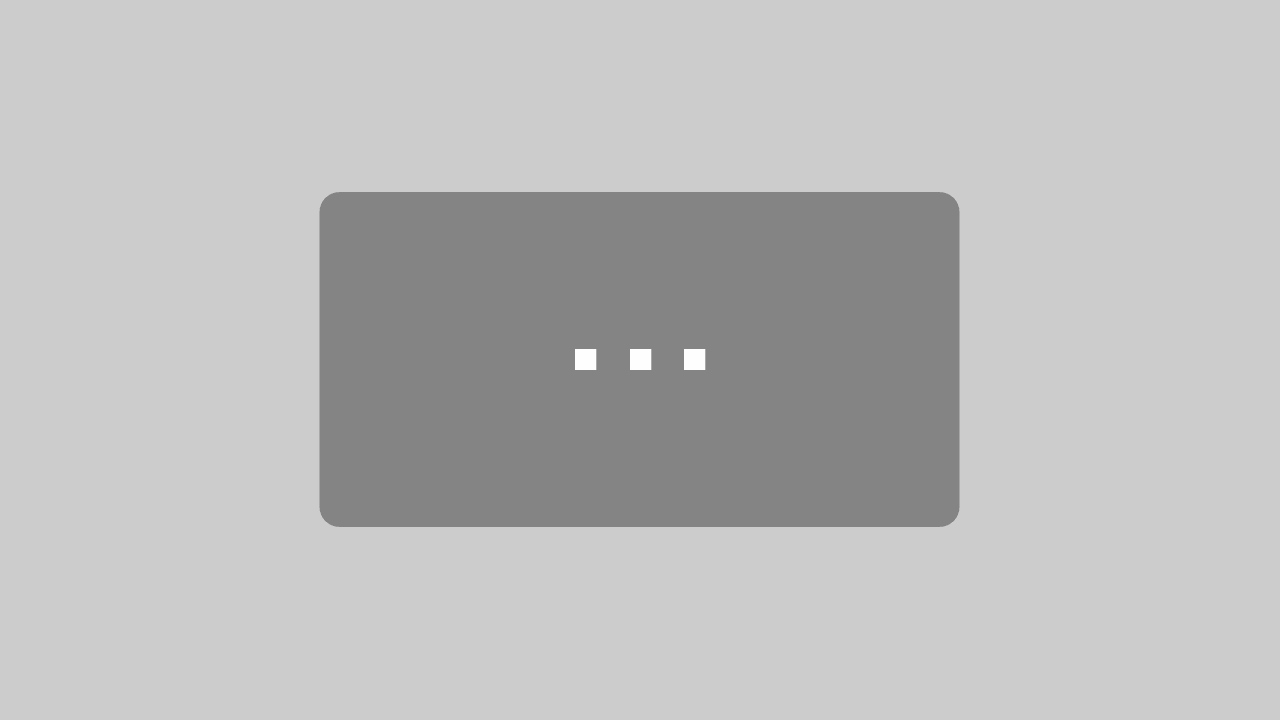
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Gestern sah ich eine Dokumentation: Weihnachten in Straßburg, oder wie Frankreich sag: Strasbourg. Die, um ein strapaziertes Wort zu benutzen, pittoreske deutscheste Stadt Frankreichs im schönen Elsass weckte in mir spontane Reiselust. Wäre das nicht, so die pandemische Lage es zulässt, ein schönes Ziel für einen vorweihnachtlichen Kurzurlaub? Antwort: Ja, mit Sicherheit.
Eine kurze Recherche ergibt eine Überraschung. Die effizienteste Verbindung von Berlin in das rund 750 Kilometer entfernte, weinblatt-begrünte Elsass bietet ausgerechnet die vielgescholtene Deutsche Bahn. In rund sechseinhalb Stunden könnte ich bereits dort sein. Mit Umstieg in Mannheim, für rund 70 Euro pro Person und Strecke. Mit dem Auto dauert die gleiche Fahrt runde neun Stunden. Und die Stadt Strasbourg kündigt im Vorfeld des Weihnachtsmarktes großräumige Absperrungen an. Viele Parkplätze sind dann nur noch für Anlieger geöffnet. Das klingt nach teurem und kompliziertem Parken, nebst den aktuell hohen Kosten für zwei bis drei Tankfüllungen. Und das Flugzeug? Strasbourg liegt etwas abseits der großen Flugrouten. Vier Stunden reine Flugzeit mit Umstieg in Amsterdam, fast doppelt so teuer wie das Zugticket – wenig verlockend.
Es gibt also bereits heute Strecken, auch außerhalb des Nahbereichs, die sich am effizientesten mit dem umweltfreundlichsten Verkehrsmittel zurücklegen lassen. Es bleibt aber eine Mutprobe: Die Umsteigezeiten berechnet die Bahn in ihrem Assistenten eher knapp. Und die Verspätungsquote der Bahn beträgt auf Fernverbindungen im Oktober 2021 fast ein Drittel. Nur 67,6 Prozent der Züge fuhren pünktlich (was die Bahn bekanntlich mit einer Verspätung von weniger als sechs Minuten gleichsetzt). Ob mir das zu spannend wird?
Von Björn

Verkehrte Ampelwelt: Die Stadt Karlsruhe dreht das Prinzip „Bedarfsampel“ um. Normalerweise melden Fußgehende an solchen Ampeln ihren Wunsch an, die Straße zu überqueren. Das Lichtzeichen schaltet dann um und stoppt den Autoverkehr. Versuchsweise bleiben nun an zwei Kreuzungen die Fußgängerampeln dauerhaft auf Grün. Autofahrende dürfen erst fahren, wenn die Ampel sie registriert.
Das funktioniert so: Eine induktive Schleife im Asphalt oder ein Radargerät an der Ampel stellt fest, wenn sich ein Auto der Ampel nähert. Die Fußgängerampel springt sieben Sekunden später auf Rot um, um den Weg für den Autoverkehr freizumachen. Nach einer knappen halben Minute haben die Autofahrenden wieder Rot, die Ampel für die Fußgänger ist (und bleibt) Grün.
Das Pilotprojekt „Grünes Licht“ soll die schwächeren Verkehrsteilnehmer bevorzugen und fördern. Das Ziel: Ein schnelleres, innerstädtisches Vorankommen ohne Auto und eine erhöhte Sicherheit. Auf diese Weise würden weniger Menschen die Kreuzungen bei Rot überqueren. Die Hochschule Karlsruhe begleitet das Projekt und wertet die Ergebnisse aus. Das Prinzip könnte also in bestimmten Stadtbereichen zum neuen Standard werden.
Von Constantin

Eine „wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltige, geteilte Mobilität“. So sieht die „Plattform Shared Mobility“ ihre Mission. Das klingt gut, stößt in der Realität aber an Grenzen. Und dann muss aufgeräumt werden: Gemeinsam mit einer Bürgerinitiative hat der Verband der Roller- und Autoverleiher allein in Köln insgesamt 113 Elektroscooter aus dem Rhein gezogen. Die werden dann von den verleihenden Firmen abgeholt und recycelt.
Dass dies nötig ist zeigt, dass Teile unserer Gesellschaft nicht bereit sind für „Shared Mobility“. Offenbar findet nicht jeder, dass das Versenken batteriebetriebener Geräte im Rhein so vermeidenswert ist wie das Auflegen der flachen Hand auf die heiße Herdplatte. Das ist schade, nicht nur für die Fische. Der Rhein ist auch für uns Menschen eine wichtige Trinkwasserquelle.
Würde ein Roller auch im Rhein landen, wenn ihn jemand privat für einen hohen dreistelligen Betrag (oder mehr) gekauft hätte? Ein Teil der Antwort: Bei der Aufräum-Aktion wurden unter anderem sieben Fahrräder und ein Rollator gefunden. Gegenstände also, die in der Regel einen Privatbesitzer haben. Und sie werden offenbar deutlich seltener im Rhein versenkt, obwohl es in Köln keinesfalls weniger Fahrräder als E-Scooter gibt.
Mehr Eigentum kann dennoch nicht die Zukunft der „Shared Mobility“ ein, klar. Aber vielleicht weniger Anarchie durch mehr Kontrolle. Die Werkzeuge kennen wir aus dem Arsenal der Auto—und Fahrradvermietung: Ein zu hinterlegendes Pfand für Entleihende zum Beispiel, und feste Abgabe-Stationen, an denen die Fahrzeuge angeschlossen werden müssen. Sonst gibt es das Pfand nicht zurück. Also quasi mehr heiße Herdplatte zum Wohle der Menschen und Fische.
Von Björn
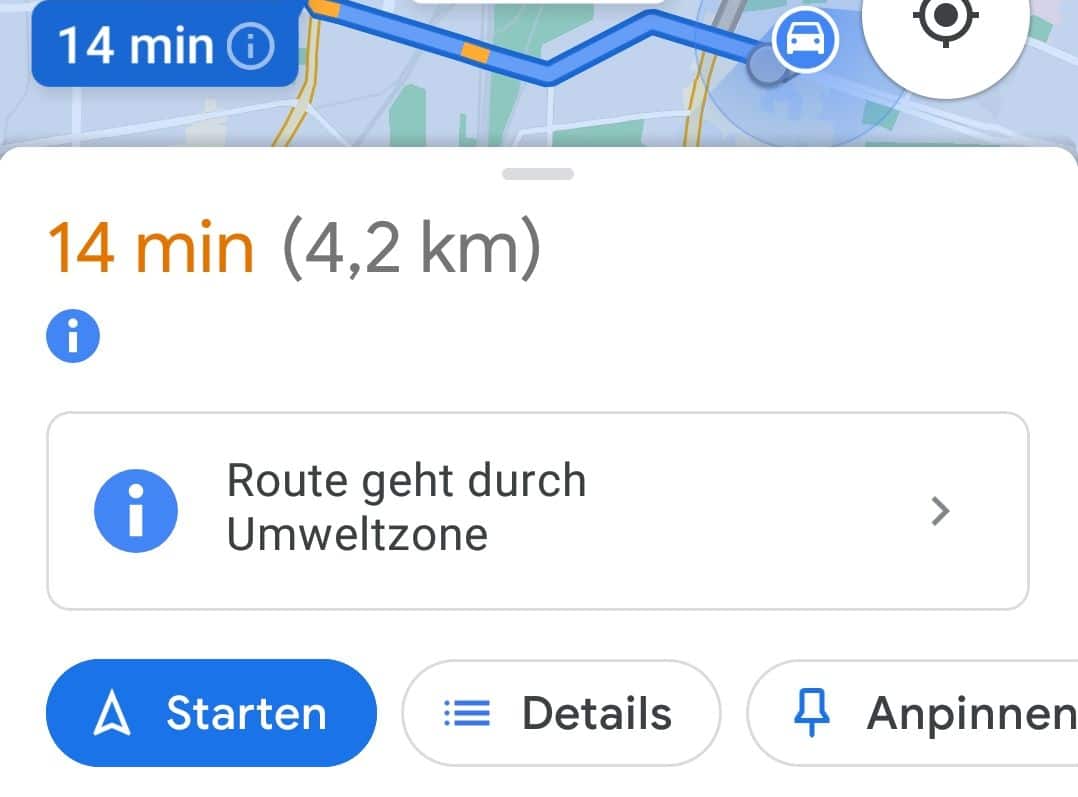
Eines vorab klargestellt: Google Maps ist ein Wunder, das mehr Mobilität ermöglicht als früher alle Falk-Pläne (ältere wissen, was gemeint ist) zusammen. Google kennt seine Nutzer*innen zudem genau. Wer Maps nutzt, hat zunächst einmal gerade Freizeit oder Urlaub. Und sucht vorrangig Restaurants, Kaffee, Hotels und Kosmetikstudios. Wer irgendwo ist, will „die Umgebung erkunden“. So weit so gut – Google vermisst die Welt nun einmal als Shopping-Paradies.
Manchmal jedoch möchte Google Maps besonders hilfreich sein. So großartig die App Informationen verknüpft: Hey Google, Folgendes ist irrelevant. In meiner Stadt informiert Google bei der Routeneingabe seit einigen Wochen prominent darüber, dass es durch die Umweltzone geht. Und schlägt vor: Schau bei der Verwaltung nach, ob Dein Fahrzeug betroffen ist. Hey Google, die Umweltzone gibt es seit mehr als 10 Jahren. Mehr als 90 Prozent aller hier zugelassenen Fahrzeuge dürfen sie befahren. Verständlich wäre ein (nicht erfolgender) Hinweis, dass ausländische Kfz auf Besuch eine Plakette benötigen – auch Elektroautos. Aber wo ich wohne, weiß Google vermutlich besser als ich selbst. Nämlich nicht im Ausland.
Was Maps auch weiß: Wer ein Krankenhaus sucht, hat vermutlich Corona und wird vorsorglich aufgefordert, seinen Arzt zu kontaktieren, statt ins Krankenhaus zu fahren. Hey Google, laut Google gibt es rund 30.000 Krankheiten. Und vielleicht möchte ich ja dort eine Pizza ausfahren (stimmt nicht) oder jemanden besuchen (das wars)? Und, hey Google: Ich wäre schneller dort, wenn ich nicht erst bestätigen müsste, dass ich wirklich dorthin möchte, obwohl es bald schließt.
Von Björn

Neue VBB-Tickets: Zielsicher an den Pfosten
Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt: Expert*innen, Fahrgastverbände, Kommunen fordern landauf, landab von den ÖPNV-Trägern flexiblere Ticketangebote, um den Nahverkehr wieder attraktiver zu machen. Dem geht es nämlich gar nicht gut. Viele Menschen meiden seit Beginn der Corona-Pandemie Bus und Bahn, bleiben daheim oder gewöhnen sich an Alternativen wie Rad und Auto. Vor allem für Pendelnde, die nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren, lohnt sich das starre Monatskarten-Abo nicht mehr. So weit die messerscharfe Analyse.
Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat nun nach langem Anlauf (9 Monate Verhandlung) den Elfmeter zielsicher an den Pfosten gedonnert. Flexiblere Tickets kommen: Ein Bundle aus acht Tageskarten, die in einem Monat abgefahren werden müssen, wird für zwei Jahre in der Hauptstadt Berlin getestet. Es kostet 44 Euro, also gut halb so viel wie eine Monatskarte (86 Euro).
Für Pendelnde geht das aus zweierlei Gründen am Bedarf vorbei: Erstens, wer morgens zur Arbeit fährt und abends nach Hause, braucht keine teure Tageskarte. Zweitens, ein Verfallsdatum von 30 Tagen hat nicht viel mit Flexibilität zu tun. Und sparen lässt sich auch nichts: Wer an acht Tagen zur Arbeit fährt, greift bisher meist zur Vier-Fahrten-Karte. Vier dieser Karten kosten 37,60 Euro – Gültigkeit unbegrenzt.
Das „flexiblere Angebot“ ist also teurer und unflexibler als vorhandene Angebote, vor allem für die anvisierte Zielgruppe. Gut möglich, dass der zweijährige Test daher ergibt, dass die Berliner*innen das Angebot nicht annehmen. Wollen die etwa keine flexiblen Angebote? Gegenfrage: Will der VBB sie wirklich vom Auto in die U-Bahn locken? Oder ist das ein Alibi-Elfer? Ebenfalls im Gespräch war eine Einzelfahrschein-Zehnerkarte. Der Schuss hätte vermutlich besser gesessen.
Von Björn

Italiener*innen sind die besseren Autofahrer*innen
Von außen betrachtet geht es im italienischen Straßenverkehr wild zu. Wer im Urlaub deutsche Regeln gegen dolce vita tauscht, der kennt das: Tempolimits sind freundliche Empfehlungen, Parkplätze Auslegungssache und Berufsverkehr – sagen wir: anspruchsvoll. Kreative Köpfe eröffnen Fahrspuren, wo gar keine sind, oder bewegen sich auf zwei Spuren gleichzeitig. Vorfahrt hat, wer sich mehr traut. Nicht leicht, in diesem Chaos eine Struktur zu erkennen. Besonders dann, wenn der Autovermieter jeden zusätzlichen Kratzer vergolden möchte.
Nach einiger Zeit entwickelt sich das augenscheinlich unkoordinierte Durcheinander aber zu einem fairen Miteinander. Denn den Italienern scheint der Drang zu fehlen, mit aller Gewalt auf ihr Recht zu bestehen. Straßenverkehr ist hier kein Wettbewerb, sondern ein Problem, das alle gemeinsam lösen. Es stehen ja alle im Stau. Da kann dann auch jeder etwas dagegen tun.
Wie sich das auswirkt? Mit Rücksicht. Jeder Autofahrer scheint seine Umgebung vollumfassend im Blick zu haben. Die Autofahrenden antizipieren Gefahren, beobachten ihre komplette Umgebung und lösen Probleme im Zweifel selbstlos. Wenn der Angeber im Sportwagen deshalb schneller ankommt, ist das nicht schlimm. Schließlich hat der gesamte Stau etwas davon, wenn es weitergeht.
Klar – ganz ohne Schrammen und Kaltverformung geht es nicht. Und eine Hupe funktioniert erst dann als Kommunikationsmittel, wenn sie selten schweigt. Das gehört offenbar dazu. Dafür lösen Überblick und Nachsicht fast jedes Problem. Beides fehlt mir enorm, wenn ich in meiner Heimat Berlin unterwegs bin. Sollten wir deshalb alle temperamentvoller fahren? Eher nicht. Aber ein bisschen italienische Inspiration täte uns allen sehr gut. Fahren und fahren lassen!
Von Constantin

Ken Block fährt Elektroauto
Es ist nur eine kleine, unbeachtete Meldung. Die Audi AG, Autohersteller aus Ingolstadt, hat sich ein neues Testimonial geleistet, also einen Prominenten, dessen Prominenz auf das Image der marke abstrahlen soll. Ken Block fährt künftig für Audi Elektroautos. Wer sich fragt, wer das ist, hat vermutlich weder Benzin im Blut noch einen YouTube-Account. Nicht schlimm, wir können helfen: Kenneth Paul Block stammt aus Kalifornien, ist 53 Jahre alt und eine Online-Ikone für PS-Verrückte.
Offiziell firmiert Ken Block als Rallye- und Rallyecross-Fahrer. Zum YouTube-Star wurde er durch seine spektakulären “Gymkhana”-Videos. In diesen driftet und springt der Amerikaner in stark leistungsgesteigerten Autos seines bisherigen Sponsors Ford mit durchdrehenden Reifen und röhrendem Motor durch abgesperrte Innenstädte (Los Angeles, London), rast die Bergrennen-Piste am Pikes Peak hinauf oder dreht einfach nur auf einem großen Parkplatz Kreise. Gummi brennt, Motoren laufen heiß, schwarze Schleifspuren verzieren den Asphalt. Eine irre Show, die Millionen Zuschauer fasziniert.
Bislang sitzt Ken Block dabei beispielsweise in einem 650-PS-Rallye-Fiesta, einem Ford Focus RS oder in seinem liebevoll “Hoonicorn” getauften 845-PS-Allrad-Mustang. Und nun in Elektroautos? Ken-Block-Fans dürfte es körperliche Schmerzen bereiten, dass Audi ihn sagen lässt: „Die Zukunft gehört der Elektromobilität“. Auch, dass seine Kinder den Sound von E-Motoren “genauso cool” finden wie den von Verbrennungsmotoren, sind schlechte Nachrichten für Gymkhana-Fans.
Dem elektrischen Fahren könnte ein Ken Block dagegen durchaus zu mehr “Wow-Faktor” verhelfen. Ein echter Lenkrad-Künstler, der auf YouTube verrückte Sachen mit leisen Autos macht, spricht eine andere Zielgruppe an als abgefilmte Schnellade-Kurven oder möglichst effiziente Stromspar-Vergleichsfahrten. Ob Ken Block der Ken Block der E-Mobilität sein kann? Das wird davon abhängen, ob seine alten Fans akzeptieren, dass er keinen Turbo röhren lässt.
Von Björn

Sharing leads to caring
Manche Dinge gibt es nur in diesen innerstädtischen Hipster-Stadtteilen, in denen sich eine wohlsituierte Intelligenz nachhaltig selbst bestätigt, dachte ich neulich. Warum? Wir bekamen eine E-Mail von unserer Hausverwaltung, die man so nicht alle Tage bekommt. Zitat:
“Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter! Wir haben ein französisches Post-Lasterrad auf den Hof gestellt, das alle Mietparteien gerne nutzen können. Die Kennung für das Zahlenschloss lautet ------------. Für ggfs. notwendige Reparaturen an dem Lastenrad kommen wir auf. Sie können auch gerne eine Fahrradpumpe für das Rad anschaffen (die Kosten werden erstattet).”
Die Hausverwaltung
Eine Idee des Vermieters, die so nett klingt, dass sie bei uns skeptischen Großstädtern sofort die Misstrauensmaschine anwirft. Zwar existiert hier noch eine funktionierende Hausgemeinschaft, so dass nicht zu befürchten ist, dass jemand das verordnete Gemeinschaftsrad direkt in den Kleinanzeigen inseriert, um die nächste Stange Zigaretten zu finanzieren. Brigitte aus dem Vorderhaus freut sich auch schon, dass sie demnächst bequemer einkaufen fahren kann als mit einer Hand am Lenker ihres klapprigen Klapprads und mit der anderen an einer übervollen Einkaufstüte. Trotzdem: Was steckt dahinter? War das Postrad übrig und musste weg? Hofft die Hausverwaltung, so den regelmäßigen Schrottrad-Wildwuchs im Hof eindämmen zu können?
Es ist ja nicht zu leugnen: Hier stehen einige Räder mitunter noch sehr lange und belegen Stellplätze, nachdem die betreffenden Mieter längst ausgezogen oder die Kinder dem einstmals ziemlich coolen Baumarkt-Mountainbike längst entwachsen sind. Für sie fühlt sich niemand verantwortlich. Vielleicht kommt Bodo ja doch noch mal aus dem Allgäu vorbei und holt sein verrostetes Ungetüm ab? Eher nicht. Insofern bin ich gespannt, ob ein Rad, für das sich alle verantwortlich fühlen dürfen (aber niemand muss), genauso rostig und plattgestanden endet wie jene, für die sich irgendwann niemand mehr verantwortlich fühlen mag. Oder ob es uns Mieter näher zusammenbringt, im gemeinsamen Kümmern um unsere gemeinsame Infrastruktur. Eine Pumpe habe ich ja schließlich, die darf gerne auch Kai aus dem 4. Stock benutzen. Eine große Mission für ein bescheidenes, altes französisches Postrad.
Von Björn
